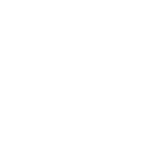Mentale Gesundheit in der Klimakrise
62. IPU-Kongress vom 30.05-02.06.24 im Ökodorf Sieben Linden



Kurzbericht
Vom 30. Mai bis 2. Juni fand der 62. IPU-Kongress statt, diesmal mit dem Thema „Mentale Gesundheit in der Klimakrise“.
Trotz des Regenwetters am Ankunftstag, welches den Aufbau und die erste Nacht in den Zelten erschwerte, blieb die Stimmung der Teilnehmenden ungetrübt. Dank der zugewandten und offenen Gruppenatmosphäre war es allen möglich, sich in den Gruppengesprächen und im sonstigen Austausch zu öffnen, was gerade bei dem sehr persönlichen Thema Klimagefühle eine große Bereicherung darstellte.
Auch ein Awareness-Team wurde durch die IPU mit Vorbereitung und Material ausgestattet und durch eine Gruppe von Teilnehmenden gestellt, sodass es zu jeder Zeit möglich war, sich bei persönlichen Problemen oder Erfahrungen mit Diskriminierung im vertraulichen Rahmen an die Ansprechpersonen zu wenden.
Zuerst durften wir in einem sehr spannenden Einstieg mit einer Keynote von Prof. Gerhard Reese einiges zur Datenlage und dem Zusammenhang von planetarer und mentaler Gesundheit erfahren.
Die Teilnehmenden hatten in den darauffolgenden Tagen die Möglichkeit, sich in den Workshops über verschiedene Gefühle zu informieren und auszutauschen, die im Zusammenhang mit der Klimakrise auftreten können – Angst und Wut, aber auch Hoffnung und Solidaritätsgefühl.
In Rahmen des Embodiment-Workshops und verschiedener Selbsterfahrungsangebote während des Kongresses, konnten die Teilnehmenden einen Zugang zur Wahrnehmung ihrer Gefühle und anderer Eindrücke im Zusammenhang mit der Klimakrise sowie zu unterschiedlichen Körperempfindungen finden.
Auch zur Reflexion und der Vernetzung untereinander fanden sich Gelegenheiten. Somit war ein Austausch zwischen Interessierten aus unterschiedlichen Fachbereichen möglich, der den Kongress als Ganzes sehr bereicherte.
Das Ökodorf Sieben Linden bot uns nicht nur wunderschöne Seminarräume zur Durchführung unserer Workshops, sondern auch eine vielfältige und sehr leckere Verpflegung.



Folgende Workshops fanden statt:
Nachhaltiger Aktivismus
Achtsamkeit als innere Haltung und stetige Übung ist ein wirksames Tool gegen Burn-out. Sie fördert ein genaueres Hinschauen im Hier und Jetzt, statt sich zu betäuben oder Zukunftssorgen zu dramatisieren. Indem wir auf unsere inneren Prozesse von Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen schauen, gewinnen wir diesen Hauch von Distanz, der uns erlaubt, nicht immer alles zu glauben, was wir denken und fühlen. Achtsamkeit fördert Gelassenheit und ermöglicht mehr Toleranz von Ambivalenz und Unsicherheit. Ebenso fördert sie Freundlichkeit und Mitgefühl sich selbst und anderen gegenüber. Auch wenn Achtsamkeit kein Allheilmittel ist und Trauma-sensibel gelehrt und geübt werden muss, kann das Eingeübte doch gerade in Krisenzeiten sehr hilfreich sein. Der Fokus des Workshops liegt auf gemeinsamem Üben von geführten Meditationen und dem Besprechen der Erfahrungen.
Protokoll: WS nachhaltiger Aktivismus
Klimakrise: Was für Gefühle und Gedanken tauchen auf - und warum? Ein Praxisworkshop zu Klimagefühlen
Wir reißen große Löcher in das Netz des Lebens, das unsere wunderbare Erde umspannt und durchwebt. Die Systeme, die unser gewohntes Leben halten, zeigen immer häufiger Risse und es droht deren Zusammenbruch. Bereits Ende dieses Jahrhunderts wird sich die Erde um mindestens 2,7 Grad aufgeheizt haben – mit dramatischen Folgen für unzählige Menschen und Lebewesen, die ihrer gewohnten Lebensräume beraubt werden. Wir verlassen den stabilen klimatischen Korridor, der uns verlässliche Lebensbedingungen ermöglicht hat. Zudem leben wir in einer Gesellschaft, die über dieses Thema und die damit verbundenen Gefühle wie Trauer, Verwirrung, Ohnmacht, Taubheit, Wut und Angst schweigt. Was da auf uns zurollt, stellt uns vor schwerwiegende emotionale Herausforderungen. Es ist nicht leicht, sich dem Klimathema oder dem Artensterben als Arbeitsgebiet oder Thema kontinuierlich zuzuwenden. Der Workshop bietet dir die Möglichkeit, nach den Gefühlen und Gedanken Ausschau zu halten, die hinter unseren alltäglichen Handlungsmustern verborgen liegen. Dabei geht es in diesem Workshopnicht um Lösungen. Im ersten Teil erkunden wir die Wahrnehmung der komplexen Wirklichkeit: Was taucht auf? Was macht das mit uns? Im zweiten Teil können wir auftauchende Fragen und Themen inhaltlich und praktisch vertiefen und der Frage nachgehen, warum diese Gefühle und Gedanken auftauchen, was sie auslöst und wie sie uns beeinflussen.
Protokoll: WS Klimagefühle Praxis
Die Hoffnung stirbt zuletzt?!
Welche Rolle spielt Hoffnung für die Klimabewegung? Bei gleichbleibenden Emissionen bleiben uns noch ca. 7 Jahre, bis wir unser Treibhaus-Gas Budget für das 1,5°C Ziel überschreiten. Sieben Jahre, in denen beinah unvorstellbare gesellschaftliche Transformationen nötig sind. Wie können wir, die sich für das 1,5°C Ziel einsetzen, noch Hoffnung haben? Wie können wir, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, nach außen weiterhin kommunizieren, dass das gute Leben für alle möglich ist, während Resignation, Angst und Erschöpfung einige von uns übermächtigen? Und auf wen oder was hoffen wir eigentlich? Besonderheiten: Wir widmen uns diesen Fragen in einem ergebnisoffenen Austausch, beschränken uns dabei aber nicht nur auf politische Diskussionen. Wir möchten auch über den persönlichen und individuellen Umgang mit der Hoffnung sprechen. Dafür greifen wir sowohl auf theoretische, als auch auf bewegungs- und körperbasierte Zugänge auf Emotionen zurück.
Protokoll: WS Hoffnung stirbt zuletzt
Regenerative Kulturen
Wie können wir die Wirkungen des toxischen Systems in uns erkennen, unsere Gefühle und Gedanken dazu mit anderen teilen, um so einen Transformationsprozess zu ermöglichen – in uns, in unseren Gemeinschaften und global? In diesem Workshop befassen wir uns mit dem Grundverständnis von regenerativen Kulturen. Es wird einen Input geben: Wie verstehen wir Regenerative Kultur? Auf welchen Ebenen können wir sie betrachten? Was bedeutet das für mich persönlich und meine Privilegien? Darüber hinaus bieten wir euch Übungen und Austauschmöglichkeiten.
Protokoll: WS regenerative Kulturen
Klimagerechtigkeit und Wut
Wann warst du das letzte Mal so richtig wütend? Welches Verhältnis haben wir zu Wut? Wann ist Wut empowernd, wann scheint sie destruktiv? Wer darf wütend sein und wer nicht? Welche Rolle spielt Wut im Aktivismus? Geben wir Wut ausreichend Raum? Und ist die Klimagerechtigkeitsbewegung wütend genug? In dem Workshop wollen wir mit euch Wut im Kontext von Klimagerechtigkeit sprechen. Wir beleuchten dabei politische sowie psychologische Perspektiven und arbeiten persönliche Reflexionsanstöße heraus. Unser ergebnisoffener Austausch bildet sowohl Raum für politische Diskussionen als auch persönlichen Erfahrungsaustausch im Umgang mit Wut. Besonderheiten: Wir arbeiten im Workshop in Kooperation mit dem Wandelwerk und greifen psychologische Perspektiven zum Thema Klimakrise auf. Gemeinsam lernen wir mehr zu theoretischen Ansätzen und Emotionen, als auch bewegungs- und körperbasierte Emotionen des eigenen Körpers erfahrbar zu machen.
Protokoll: WS Klimagerechtigkeit und Wut
Klima-Gesprächsrunden
Wo und mit wem sprichst Du über die „Klimakrise“? Die Überschreitung diverser planetarer Grenzen, kurz Klimakrise genannt, lässt kaum eine*n von uns kalt. Trotzdem glauben wir mehrheitlich nicht, dass es anderen auch so geht, dass sie Gefühle dazu haben und sich z.B. sorgenvolle Gedanken machen. Dabei würde es uns so sehr helfen, darüber zu reden. Gruppenformate können sichere und mutige Räume bereitstellen, um Gefühle zu verarbeiten und ein Gemeinschaftsgefühl und gemeinsame Sinnhaftigkeit kreieren. Gemeinsame Verletzlichkeit kann die emotionale Belastung erträglicher machen. Unsere Gedanken, Gefühle und Erfahrungen zu teilen, kann neue Wege eröffnen und ein tieferes Engagement ermöglichen. Es gibt verschiedene Formate, die kurz vorgestellt werden. Wir wollen in diesem interaktiven Workshop die Grundlagen dazu gemeinsam erarbeiteten. Was brauche ich, um mich sicher genug für mutige Gefühlsexplorationen zu fühlen? Was, um so einen Raum als Moderator*in zu schaffen und zu halten? Wie kann ich mit herausfordernden Situationen umgehen? Abschließend wenden wir das Erarbeitete in einer kürzeren Gesprächsrunde an.
Protokoll: WS Klima-Gesprächsrunden
Umgang mit Klimagefühlen
Ob Schreiben, Meditieren, eine Demo organisieren – In diesem Workshop lade ich euch ein, eure ganz eigenen Wege des Umgangs mit Klima- Gefühlen zu erkunden. Welche Bewegungen rufen sie in euch hervor? Welche Beziehung pflegt ihr zu ihnen? Und auf welche Weise beschränken sie euch möglicherweise? Dieser Workshop ist offen für alle, die ihre Reaktionen auf Klima-Gefühle besser verstehen möchten und ihren Handlungsspielraum erweitern wollen. Ich setze auf eine Atmosphäre des gemeinsamen Austauschs, da ich davon überzeugt bin. dass wir alle voneinander profitieren können. Besonders wichtig ist, dass keine Wertungen vorgenommen wird, ob eine Bewältigungsstrategie „gut“ oder „schlecht“, „besonders hilfreich“ oder „unnötig“ ist. Jede Form des Umgangs wird als legitim betrachtet, und wir erkunden gemeinsam die Vielfalt der Reaktionen und ihre Wirkungen.
Protokoll: WS Umgang mit Klimagefühlen
Activist Burnout Ade - Wir können wir Klimaprotest und Engagement resilient gestalten?
Der gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise ist kein Sprint, wir brauchen eine Klimabewegung mit einem langen Atem. Dafür ist zentral, dass wir resiliente Gruppen schaffen, die ein langfristiges und gesundes Klimaengagement fördern. In der Praxis beobachten wir jedoch häufig, dass Individuen sich aus ihrem Engagement zurückziehen, da sie erschöpft sind und nicht mehr können. Der Workshop gibt einen Einblick in psychologische Forschung zum Thema Activist Burnout und Resilienz im Aktivismus und bietet Möglichkeiten zur persönlichen Reflektion. Darauf aufbauend wollen wir gemeinsam überlegen und erproben, wie wir unsere Gruppen gesund und widerstandsfähig gestalten können. Dabei sind sowohl bereits Engagierte willkommen als auch Menschen, die Lust haben, aktiv zu werden.
Protokoll: WS Activist Burnout
Dialog üben für mehr Klimakommunikation: Reflektion zum eigenen Handlungsspielraum und konkretes Handwerkszeug für nachhaltige Gespräche
Mit wem spreche ich über die Klimakrise? Und wie? Wann „gelingt“ ein Gespräch, auch wenn mein Gegenüber eine andere Sicht hat als ich? Wie kann ich Verbindung aufbauen und halten und wann wann muss ich mich abgrenzen? Und schließlich: wie weit möchte ich mich überhaupt hineinbegeben in den ergebnisoffenen Dialog? In diesem Workshop lasst uns erkunden, wie wir in Gesprächen rund ums Klima wir selbst bleiben und lasst uns üben! Denn wir alle dürfen und sollen mitreden in unserer Demokratie. Wieso lohnt es sich das Gespräch zu suchen, sogar auch mit politischen Entscheidungsträger:innen? Unsere Emotionen, unsere Ängste, unsere Wut sind wichtig! Vielleicht denkst du bisher, „die“ hören nicht zu, sind nicht interessiert. Vielleicht traust du dich nicht, weil du glaubst, du weißt nicht genug…. Wir tauschen uns aus und erforschen auf Basis unserer bisherigen Erfahrungen, wie wir Gespräche professionell und engagiert gestalten können. Dabei dürfen wir aus dem Erfahrungsschatz der Bürgerlobby Klimaschutz (CCL- Deutschland) schöpfen, die im Jahr zahlreiche Gespräche mit Politiker:innen auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene führt. Es ist relevant gut vorbereitet zu sein. Gleichzeitig treffen wir als Menschen auf Menschen und wollen in einen nährenden Austausch kommen. Wie funktioniert das? Was dürfen wir nicht übersehen? Wie erhalten wir unsere Motivation und machen sie sichtbar?
Protokoll: WS Klimakommunikation CCL
AU JA, voller Kraft voraus: Ein Gruppenspiel für unser Engagement
Das Spiel AU JA! hilft dir und deiner Gruppe bei Selbstfürsorge und nachhaltigem Klima- oder Umweltengagement kann kräftezehrend sein. Sich mit anderen zu verbinden, ist ein wichtiger Schritt, um aus der eigenen Ohnmacht herauszukommen und sich wirksamer zu fühlen. Wenn du AU JA! spielst, erlebst du eine spannende Mischung aus achtsamer Selbstfürsorge, Selbstreflexion und Gruppenaktivitäten. Du und deine Gruppe lernen so, Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig Grenzen zu akzeptieren. Ihr könnt erleben, wie gemeinsame Wirksamkeit aus der Wirksamkeit jedes Einzelnen erwächst. AU JA! ist für alle, die sich bereits in Klima- oder Umweltgruppen engagieren oder es vorhaben. Es ist für Menschen, die bereit sind, sich zu öffnen und über ihre eigenen Gefühle zu sprechen.
Protokoll: WS Au Ja
Gesundheit und Psychotherapie in der Klimakrise - Wie hilft Embodiment der Klimakrise mit Resilienz zu begegnen?
Was heißt das für hilfreiche Therapie? Welches Verständnis von Gesundheit ist dafür die Grundlage? Embodiment heißt Verkörperung. Unser Geist, und unser Körper sind auf vielfältigste Art und Weise miteinander verbunden und in Wechselwirkung. Unsere Zeit betont den schnellen Geist, unsere Welt wird zunehmend globaler, digitaler und reizüberfluteter. Das macht es immer schwerer bei sich zu bleiben, in sich zu lauschen und wahrzunehmen, was jetzt gerade ist, mit allen Sinnen. Und die Verbindung zu halten zu all den wesentlichen Informationen in unserem Innen. Wir können gut funktionieren, aber wie wäre die Welt, wenn wir uns mehr mitnehmen mit dem, was in uns ist. Müdigkeit, Neugier, Sehnsucht, Lebenslust, … Embodiment heißt auch das eigenen Nervensystem besser kennenzulernen. Wann fühle ich mich sicher? Wie reagiere im Stress und wie erlebe ich Selbst- und Coregulation. Wenn ich immer mehr bemerke, wie mein Nervensystem automatisch reagiert, habe ich in Konflikten und Herausforderungen andere Handlungsmöglichkeiten. Und kann dann auch die Nervensysteme der Anderen besser wahrnehmen und verstehen. Das Feld wird sicherer und Sicherheit schafft Weite, Und im Embodiment geht es um Verbindung. In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr Einsamkeit. Dabei sind wir auch alle verbunden. Verkörpert erleben, dass ich beantwortet werde, hinspüren, wo es Kontakt und Berührung braucht, Grenzen wahrnehmen, zwischen Ich und Wir hin und her pendeln, schafft ein Feld von Aufgehobenheit. Wir sind soziale Wesen, die einander brauchen. Und wir können andere Menschen und Verbundenheit nur dann spüren, wenn wir darin auch uns selbst spüren. Wenn wir uns trauen in uns zu lauschen, nicht schon zu wissen, entstehen Impulse, die mehr aus unserem Selbst und unserer Mitte kommen. Wir lernen anders, tiefer, nachhaltiger. Und können andere Antworten finden und präsenter in die Welt wirken. Die Zeiten werden herausfordernder, überall nehmendie Krisen zu – was brauchen wir? Präsente, lebendige Menschen, die sich trauen, mutig neue Wege zu gehen. In meinen Workshops arbeite ich teilnehmenden und prozessorientiert, bequeme Kleidung mitbringen ist hilfreich.
Protokoll: WS Embodiment